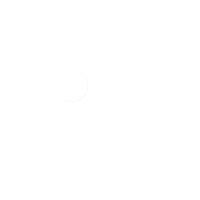Gespräch unter Fremden
LIV CHARIS CHRISTELSOHN, 2023
Sie reibt ihre Hände aneinander, so als müsse sie sich wärmen, aber es ist Sommer und die Kleidung klebt durchnässt an unseren überforderten Schulterblättern.
„Ist das da entzündet?“, frage ich und deute auf ihren Unterarm.
„Nein, nur frisch gestochen.“
Sie lächelt. Die Worte Jonas, mein Stern stehen dort geschrieben, blaue Tinte auf roter Haut, und bekunden eine Liebe, die mir fremd vorkommt. Das Tattoo ist mit einer transparenten Folie abgeklebt, unter der sich beharrlich Wundwasser zu einem kleinen See sammelt.
Auch in ihr sammelt sich ein See, zumindest sieht es danach aus.
Sie holt Luft, möchte etwas sagen, traut sich dann aber doch nicht.
„Wie geht es eigentlich Lotte?“, bringt sie schließlich hervor und ich frage mich unweigerlich, ob sie nicht doch etwas anderes sagen wollte.
„Sie ist vorletzten Sommer gestorben.“
Bedrücktes Schweigen.
Schweißperlen sickern in den Ausschnitt meines Tanktops.
„Das tut mir so leid, hättest du doch früher was gesagt.“
Ich wünschte, ich könnte einschätzen, ob sie das wirklich ernst meint. Früher hatte sie nie mehr als ein spöttisches Lächeln für Lotte übrig. An Katertagen war es nur ein Naserümpfen.
„Meerschweinchen sind fette kleine Biester. Sie stinken und fressen nur“, pflegte sie dann zu sagen und prinzipiell hatte sie nicht ganz unrecht.
Lotte war das traurige kleine Vermächtnis meiner Großmutter, die das arme Tier in ihrer senilen Vergesslichkeit vollkommen überfüttert hatte. Lotte war plump, langsam und roch nach ihren eigenen Exkrementen. Letzteres lag aber nicht an ihr selbst, sondern nur an einer unzureichenden Käfigpflege. Nach ein paar Wochen in meiner Obhut wich der Gestank einem angenehmen Heugeruch, doch sie hielt an ihrer Behauptung fest.
Haustieren konnte sie sowieso nie etwas abgewinnen. Es fiel ihr schon schwer genug, sich um sich selbst zu kümmern, die Verpflichtung für ein weiteres Lebewesen hatte da einfach keinen Platz. Am liebsten hätte sie Lotte sofort auf Ebay verschenkt, doch mit dieser Entscheidung konnte ich mich damals nicht abfinden. Ich bettelte regelrecht danach, das Meerschweinchen zu behalten. Es war vielleicht das erste und letzte Mal, dass ich etwas vor ihr offen einforderte und am Ende gab sie sich geschlagen. Unter diversen Bedingungen. Ich sollte mich allein um Lotte kümmern, musste sie füttern und pflegen und säubern. Ich verdiente bereits früh mein eigenes Geld, durch das Austragen von bunten kleinen Flyern, auf denen türkise Flüsse und hölzerne Kruzifixe abgedruckt waren.
Glauben Sie an Gott?
Ich glaubte nur an mich selbst.
Auch wenn sie mich regelmäßig in die Kirche mitnahm, am Ende konnte ich den salbungsvollen Worten und den harten, kalten Kirchenbänken nichts abgewinnen.
Ich nutzte mein kleines Einkommen, um Lotte Futter und Heu zu kaufen. Manchmal musste ich etwas von dem Geld abgeben, für eine Zigarettenpackung vom Späti oder den Weißwein im Tetrapack, der im Supermarkt ganz unten im Regal steht.
„Dein Eis schmilzt weg.“
Ich schaue auf meine Hände und tatsächlich bahnen sich rosarote Rinnsale aus geschmolzenem Himbeereis den Weg über meine Finger, bis sie traurig auf den Boden tropfen.
„Oh.“
Wir haben keine Servietten vom Eisstand mitgenommen. Eine Entscheidung, die ich jetzt bereue.
„Warte kurz.“
Sie kramt in ihrer kleinen Handtasche, von der sich bereits das Lederimitat abschält, besonders um die Ecken herum.
Es klimpert und raschelt, bis sie schließlich eine babyblaue Packung Feuchttücher zu Tage fördert. Auf der Vorderseite lächelt mich ein pausbäckiges Kleinkind mit roten Ohren und winzigen Milchzähnen unschuldig an. Mir wird etwas übel.
Ein Danke bringe ich nicht hervor, als sie mir ein Tuch reicht und ich damit notdürftig die klebrige Flüssigkeit abreibe.
Erneutes Schweigen. Wie Melasse klebt es uns an den Mündern, dunkel und zäh.
Als ich das Feuchttuch gerade zusammenknülle, fliegt eine Taube über unsere Köpfe hinweg, landet etwa zwei Meter entfernt auf einer Laterne und gurrt.
Ich halte in meiner Bewegung inne und starre zu ihr hinauf.
Ihr hellgraues Gefieder glänzt im Licht fast metallisch, durchsetzt von einem grünen Schimmer. Ein schönes Tier. Den Kopf in den Nacken gelegt, blickt sie mit ihren blanken, schwarzen Augen in die Welt.
Ich mag Tauben.
Auch wenn sie als Schädlinge eingestuft werden und Krankheiten übertragen können. Ich mag es, dass sie an Orten leben, die eindeutig nicht für sie gemacht sind. Sie nisten zum Beispiel auf den Stahlträgern in Bahnhöfen, auch wenn diese vielerorts mit Metallspikes eingekleidet sind. Irgendwie finden sie doch ihre Nischen und Ritzen, kacken Züge und Gehwege voll und kümmern sich nicht um den Rest der Welt. So möchte ich auch gern sein. Ein bisschen zumindest.
„Wann musst du los?“ fragt sie und die Taube flattert davon.
Ich schaue auf mein Smartphone, um die Uhrzeit zu checken. Mein schweißnasses Gesicht spiegelt sich im Display und guckt unweigerlich betreten drein.
Es ist kurz vor 12.
„Meine Schicht beginnt erst gegen 13:30. Ein bisschen Zeit haben wir noch.“
Ich sage es vielleicht eine Spur zu freudlos, denn sie schaut verletzt zu Boden. Ihr Blick wandert zu den Himbeereisklecksen, die sich auf dem Basaltsplitt zu unseren Füßen verteilen.
„Wusstest du, dass das kein Kies, sondern Basaltsplitt ist?“, frage ich also etwas dümmlich, in Ermangelung von reichhaltigem Gesprächsstoff.
Sie guckt nur verwirrt.
„So sagt man das doch. Man nennt das hier einen Kiesweg, ist es aber gar nicht.“
Ich weiß tatsächlich recht viel über Kieswege. Mein Freund arbeitet als Landschaftsgärtner bei der Stadt und manchmal belehrt er mich, dass es sich bei den Parkwegen, die sich in weichen Schlingen um kunstvoll bepflanzte Sommerbeete legen, eben nicht um Kies handelt. Es ist komplett überflüssiges Wissen, aber er hat ganz leuchtende Augen, wenn er darüber redet, und das macht es irgendwie erträglich.
Er redet auch gern über Trocken- und Natursteinmauern oder das Verlegen von Fertigrasen. Für die meisten sind das totlangweilige Themen, doch er ist dabei wie elektrisiert.
Sie weiß das natürlich nicht, das mit meinem Freund und seiner Arbeit, weil sie die Hälfte unseres Gesprächs kaum zugehört, sondern nur auf ihr Handy gestarrt und die Baby-App gecheckt hat.
Wir sind vielleicht fünf Minuten Fußweg von ihrer Wohnung entfernt, der Park grenzt direkt an den Gebäudekomplex, in dem sie jetzt lebt. Doch die unsichtbare Nabelschnur scheint trotzdem fest um ihr Herz oder zumindest ihr Handy geschlungen zu sein. Ein fester Strang, gewoben aus greifbarer Mutterliebe, der sie unweigerlich mit diesem kleinen Menschen verbindet, der gerade in ihrem verdunkelten Schlafzimmer vor sich hin döst.
Ich will es nicht, aber die Eifersucht kocht hoch, bevor ich dagegen ankommen kann.
Sie hatte früher Besseres zu tun, als sich um ein Kind zu kümmern. Sie musste die üblichen Clubs frequentieren, Männer abschleppen, denen sie nie von mir erzählte, und ich musste mich nachts in meinem Zimmer verstecken, um ihre Bekanntschaften nicht vorzeitig zu vergraulen. Albträume oder Einsamkeit waren in ihren Augen kein passender Grund, diese Abmachung zu brechen. Und ich? Ich wollte ihr so gern gefallen, hörte immer brav, hinterfragte sie nie.
Auch, dass ich die ersten Jahre meines Lebens nur bei meiner Großmutter verbrachte und sie kaum zu Gesicht bekam, stellte ich nicht infrage.
Als meine Großmutter dann immer kränker wurde und sie uns öfter besuchen musste, wunderte ich mich nie über ihren rauchigen, derben Geruch – der ganz und gar nicht heimelig war, so, wie ich mir das immer ausgemalt hatte.
Als ich mit dreizehn schließlich zu ihr zog, akzeptierte ich stumm ihren kühlen Blick und ihre wortkarge Art.
So ist sie eben, dachte ich. Alle Menschen sind ja bekanntlich unterschiedlich.
Tief im Inneren ahnte ich jedoch, dass ich einfach nur Angst vor ihr hatte.
Deshalb fragte ich auch nie, warum sie mich nicht in den Arm nahm oder warum sie mir nicht durchs Haar strich, so wie Mütter das machten. Ich nahm zur Kenntnis, dass sie mich nie an meine Hausaufgaben erinnern würde und dass ich mir selbst Essen kochen musste. Vorzugsweise lief das auf Tütensuppen und Tiefkühlgemüse hinaus und ich sehnte mich oft nach den dicken, weichen Pfannkuchen meiner Großmutter.
Unser Zusammenleben war von einem undurchdringlichen Schweigen geprägt.
Ich ging mit ihr jeden Sonntag in den Gottesdienst und sie sagte nichts. Ich malte ihr Bilder zum Geburtstag und sie sagte nichts. Ich kochte für sie, wusch ihre Wäsche, putzte ihr Erbrochenes aus dem Teppichboden und sie sagte nichts.
Mit sechzehn zog ich aus.
Und sie stand rauchend im Türrahmen, ganz still, eine erhabene Statur ohne einen Funken des Bedauerns im Blick.
Darauf folgten ein paar Jahre, in denen ich gar keinen Kontakt zu ihr hatte. Ich fand einen Job in der Stadt, in einem kleinen Musikladen mit vollgestickerten Scheiben und einem etwa sechzigjährigen Inhaber, der müde, liebe Augen hatte, ein bisschen nach Kernseife roch und mich jeden Tag auf einen Kaffee und Kekse einlud. Ich mochte ihn sehr und er lobte mich oft. Er war wie ein typischer Opa, nur seine Vorliebe für E-Gitarren fiel ein bisschen aus dem Rahmen.
Später lernte ich meinen Freund kennen und er ermutigte mich, eine Ausbildung zur Kunsttherapeutin anzufangen.
Dann kam der Brief.
Sie entschuldigte sich. Sie schrieb von postpartalen Depressionen und ich musste googeln, um herauszufinden, was genau sie damit meinte. Sie schrieb, dass sie nie wirklich in psychiatrischer Behandlung war. Sie schrieb auch von anderen Dingen. Schlechte Dinge, mit denen sie versucht hatte, sich zu betäuben und ihre fehlende Liebe einfach durch Stimuli zu ersetzen. Sie schrieb all das und ich hatte mich so lange nach einer Erklärung gesehnt, doch in mir blieb es völlig leer. Die Fragen, die ich nie stellen konnte, wurden endlich beantwortet, doch das Loch, das in mir klaffte, ließ sich damit nicht füllen. Ich weinte und warf den Brief weg.
Mein Freund fischte ihn wieder aus dem Müll. Ein paar Monate lang lag er knittrig und verschmäht in einer Schreibtischschublade. Dann fing ich mich und rief die Telefonnummer an, die sie für mich auf dem Brief hinterlassen hatte. Wir verabredeten uns.
Sie sah besser aus, als ich sie je zuvor gesehen hatte. Ihr Haar war gewaschen und ihre Wangen rosa. Sie trug Lavendelparfüm, ein bisschen zu viel, aber es stand ihr gut. Sie rauchte auch nicht mehr. Umarmen konnten wir uns nicht. Zwischen uns blutete noch immer etwas aus. Es heilte einfach nicht ab. Wie ein Mückenstich, den man immer wieder wund kratzt.
Sie sagte, sie wolle den gleichen Fehler nicht noch einmal machen. Das verstand ich nicht. Aber ich erwiderte, dass ich ihr Parfüm mochte und scheinbar war das Antwort genug.
Als ich sie das nächste Mal traf, war ihr Bauch bereits kugelrund. Da begriff ich es, den Brief und alles drum herum, ihre kryptischen Worte und warum sie das Rauchen aufgegeben hatte.
Ich frage unbeholfen, wo denn der Vater sei. Sie sagte, sie wisse es nicht.
Jetzt ist es da, das Kind. Jonas. Ein Junge. Ich weiß nicht, wie er aussieht. Ich habe nicht nach Fotos gefragt und möchte es eigentlich auch nicht wissen. Dafür bin ich nicht bereit. Aber sie hat schon wieder einen Blick auf ihn geworfen, jetzt gerade, auf ihrer Baby-App. Ihre Augen sind so weich und voller Liebe. Sie sieht ihn an, als sei er die größte Kostbarkeit auf der Welt. Nur, was macht das aus mir?
Der Mückenstich hat jetzt doch ganz langsam eine Kruste bekommen und ich versuche wirklich nicht mehr zu kratzen. Aber diese Frage lässt ihn jucken. Ich muss sie ganz weit wegschieben.
Er kann ja nichts dafür.
Wir sind immer noch ungelenk, wenn wir uns treffen, zwei Fremde, die ganz zufällig Mutter und Tochter sind. Sie wird mich nie anschauen können, wie sie ihn anschaut. Und da wird immer diese leise bittere Eifersucht sein. Weil er das bekommt, was ich nie haben durfte.
Weil er einfach nur ein Kind sein kann.
Und dann wird sie ihm ganz zärtlich durchs Haar streichen.
So, wie Mütter das eben tun.